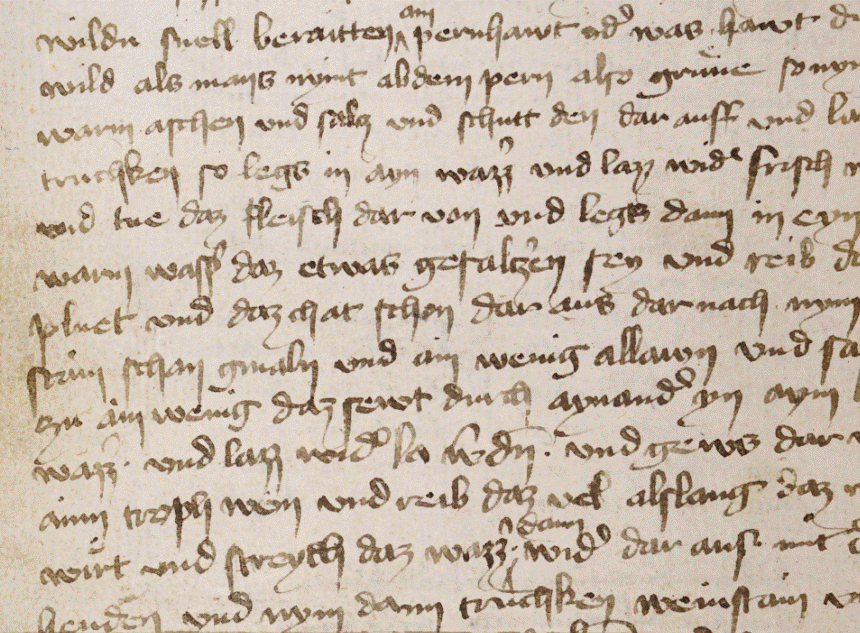Universitätsbibliothek Graz, 1236 (fol. 108v)
Pergament, 120 Bl., 210 x 150mm, Ende 14. Jh., Benediktinerstift St. Lambrecht
Handschrift
Die Handschrift überliefert im Wesentlichen die theologischen Traktate De verbo incarnato, De contractibus und die Litterae universitatis parisiensis ab aboliendum schisma (?) des Theologen, Astronomen und Naturwissenschaftlers Heinrich von Langenstein (1325-1397), der ab 1384 an der jungen Universität Wien lehrte und 1393/94 Rektor der Universität war. Vor seiner Wiener Zeit befasste sich Heinrich von Langenstein (auch Henricus de Hassia) mit der großen kirchenpolitischen Frage seiner Zeit, dem sog. Großen Abendländischen Schisma (1378–1447), in dem er sich auf der Seite von Papst Urban VI. positionierte. In der Ms. 1236 findet sich zwischen dem Traktat De contractibus und den Litterae universitatis ein deutscher Eintrag (fol. 108v), der eine Anleitung zur Herstellung von Leder bietet.
Text
(108v) nota autem conficiendi pelles cuiuscumque sint conducorum.
wildu snell beraitten ain pernhawt ader was hawt du wild, als mans nymt ab dem pern also gruene, so nym warm aschen vnd salcz vnd schutt den dar auff vnd lazz es truchken. so legs in ayn wazzer vnd lazz wider frisch werden vnd tue daz fleisch dar von vnd legs dann in eyn warm wazzer daz etwas gesalczen sey vnd reib daz pluet vnd daz chat schon dar aus. dar nach nym weinstain schon gmaln vnd ain wenig allawn vnd salcz daczu ain wenig. daz sewt durch aynander yn ayn lautter wazzer vnd lazz wider la werden. vnd gews dar vnder ainn troph wein vnd reib daz vel alslang daz weis wirt vnd streych daz wazzer dann wider dar aus mit den henden vnd nym dann truchken weinstain vnd se yn auff daz fel vnd nym chleiben vnd strew sew auff den weinstain und lazz wol truchken an der sunnen oder ander hicz. so hastu gut ledder. [leder]
Übersetzung
„Notiz zur Herstellung von Tierhäuten aller Art: Willst du schnell eine Bärenhaut oder eine andere Haut bearbeiten, wie man sie dem Bären frisch abzieht, dann nimm warme Asche und Salz und schütte diese darauf und lass es trocknen. Dann leg es in Wasser ein und lass es wieder einweichen und löse dann das Fleisch ab und leg das Fell dann in warmes Wasser, welches ein wenig gesalzen ist und reibe das Blut und das Fett sorgfältig heraus. Danach nimm gut gemahlenen Weinstein und ein wenig Alaun und salze das ein wenig. Das koche zusammen in klarem Wasser auf und lass es wieder abkühlen. Und gieß darunter ein Tropfen Wein und reibe das Fell so lange, bis es weiß wird und streich das Wasser dann mit den Händen wieder raus und nimm dann trockenen Weinstein und verteile ihn auf dem Fell und nimm Lehm und streu das auf den Weinstein und lass es an der Sonne oder in der Hitze gut trocknen. Dann hast du gutes Leder.“
Kommentar:
Im Mittelalter wurden Tierhäute durch verschiedene Verfahren zu unterschiedlichen Arten von Ledern verarbeitet. Dabei wurden am häufigsten Häute von Nutztieren verwendet. In der Handschrift 1236 aus St. Lamprecht aus dem 15. Jahrhundert wird Schritt für Schritt die Lederherstellung aus einer Tierhaut beschrieben. Besonders interessant wird es, wenn man herausfinden will, um welches Tier es sich eigentlich handelt. Wurde hier tatsächlich ein steiermärkischer Bär gehäutet?
Doch zunächst zur Lederherstellung: Das Gerben ist der wichtigste Arbeitsschritt im Prozess der Lederherstellung Die enthaarte Tierhaut wird dabei chemisch behandelt und haltbar gemacht. Je nachdem, welche Gerbstoffe verwendet werden, erhält das Leder eine andere Farbgebung. So wird unterschieden zwischen der Vegetabilen (Loh-), Sämisch- (Fett-), Rauch- oder Alaun-Gerbung. Die Praktik des vegetabilen Gerbens ist seit der Bronzezeit bekannt. Mit Fetten und Rauch wurde bereits zu paläolithischen Zeiten (bis 10.000 v. Chr.) gegerbt. Die Behandlung von Tierhaut mit Alaun, d.i. ein Salzsulfat aus Aluminium und Kalium, sorgt für die weiße Farbe des Leders.
In der Ms. 1236 wird die Lederherstellung mit einer pernhawt (nhd. Bärenhaut) beschrieben. Ob es sich allerdings tatsächlich um die Haut eines Bären handelt, ist nicht klar. Wahrscheinlicher ist die Verwendung einer Schweinehaut. Die Herkunft der Handschrift verweist auf die Steiermark und legt somit einen regionalen Dialekt nahe. Der unbekannte Schreiber könnte mit der Bezeichnung pernhawt nicht eine tatsächliche, bzw. im wörtlichen Sinne verstandene Bärenhaut meinen, sondern das Fell eines Ebers. Das männliche Schwein wird im österreichischen Dialekt häufig als „Saubär“ bezeichnet (österr.-mhd. sûbêr, swînbêr). Die dialektale Besonderheit kann somit zu Unklarheiten im neuhochdeutschen Verständnis führen. Ein weiterer Hinweis auf den „Saubären“ lässt sich zudem in der Bearbeitungsfolge des Fells finden. In der genauen Anweisung zur Vor- und Aufbereitung des Materials entfällt der Schritt des Hautabziehens. Dieser wäre in den meisten Fällen unumgänglich, um die Haut weiterverarbeiten zu können, besonders im Fall eines Bärenfells. Da Schweine in der Regel nur sehr dünnes Fell haben, könnte dies in der Beschreibung als separater Schritt in der Verarbeitung durchaus wegfallen. Somit dürfte es sich bei dieser Anleitung nicht um einen besonderen Fall zur Lederherstellung aus Bärenhaut handeln, sondern um ein hochinteressantes Beispiel für die Unterschiede in Sprache und regionalen Dialekten.
Literatur in Auswahl
- Lexikon des Mittelalters, Art. Leder, Vol. 5, cols 1789-1792.
- Zisterzienser Stift Zwettl: https://www.ziereis-faksimiles.de/faksimiles/stifterbuch-des-klosters-zwettl-baerenhaut
Annalena Santin, Projektarbeit im Rahmen des Seminars „EX Historische Medien (Mittelalterliche Handschriften)“, Institut für Germanistik (Germanistische Mediävistik, Univ.-Prof. Dr. Julia Zimmermann)